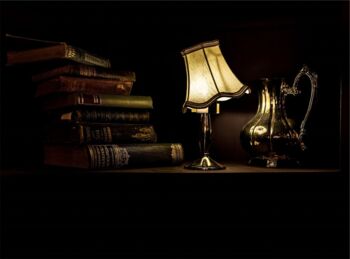
Zu Hause möchten wir uns sicher fühlen, doch der Hausfrieden kann schnell durch einen unsichtbaren Feind gestört werden. Die Rede ist von Radon, einem radioaktiven Edelgas, dessen Existenz vor wenigen Jahrzehnten unbekannt war.
Noch heute ist das Bewusstsein für die von Radon ausgehenden Gefahren nur gering ausgeprägt. Dabei nimmt das Edelgas als Verursacher tödlicher Lungenerkrankungen den zweiten Rang ein. Lediglich Nikotin ist in dieser Hinsicht gefährlicher. Etwa 1.900 Personen (1) sterben jedes Jahr in Deutschland an Lungenkrebs durch Radon. Es wird höchste Zeit, sich dieser Gefahr bewusst zu werden und Maßnahmen zur Verhütung zu ergreifen.
Wie lässt sich die Radonkonzentration im Haus ermitteln?
Da Radon sich den menschlichen Sinnen vollständig entzieht, sind Bewohner auf Hilfsmittel angewiesen. Diese liefert der Fachhandel in Form von Radonmessgeräten. Unterschieden werden die Radondosimeter in aktive und passive Radon-Messgeräte. Aktive Radonmessgeräte werden an das Stromnetz angeschlossen und liefern eine Momentaufnahme der Radonkonzentration im Haus. Sie eignen sich ebenfalls gut dafür, mögliche Eintrittsstellen von Radon im Keller zu identifizieren.
Passive Messgeräte werden hingegen in der Wohnung für drei bis zwölf Monate ausgelegt, ohne dass es hierfür Energie bedarf. Ihre Ergebnisse sind zuverlässiger, weil das Vorkommen von Radon im Haus variiert. Um das Ergebnis auszuwerten, müssen passive Radonmessgeräte in ein Labor geschickt werden. Am intensivsten ist die Radonkonzentration in zerklüfteten Bergregionen, vor allem, wenn hier aktiver Bergbau betrieben wurde. Altbauten ohne eine zeitgemäße Schutzhülle erhöhen ebenfalls das Risiko einer Radonbelastung.
Freisetzung und Krebsgefahr
Radon wird im Erdinnern durch Abbauprozesse von Uran gebildet. Dabei gelangt es durch Migration und Emanation an die Erdoberfläche. Unter „Migration“ verstehen wir die Bewegung des Edelgases durch Spalten und Ritzen Richtung Erdboden. „Emanation“ steht wiederum für Ausstrahlung. Dabei meint der Begriff die Freisetzung von Radon über feste Ausgangsverbindungen, sodass das Edelgas durch das Kristallgitter von Mineralien diffundieren kann.
Erreicht das Edelgas die Erdoberfläche, verflüchtigt es sich rasch und kommt nur noch auf einen Anteil zwischen 2 und 30 Becquerel pro Kubikmeter (2), was gesundheitlich zumeist unbedenklich ist.
Wesentlich riskanter ist es, wenn Radon über den Keller ins Haus gelangt und in dessen Mikrokosmos gefangen bleibt. Im Extremfall kann Radon im Gebäude auf eine Konzentration von über 1.000 Bq/m³ kommen. In Deutschland liegt der kritische Referenzwert bei 300 Bq/m³, während die WHO bereits ab einer Intensität von 100 Bq/m³ Alarm schlägt. Mediziner gehen auf Grundlage verschiedener Untersuchungen davon aus, dass die Krebsgefahr je 100 Bq/m³ um 16 Prozent steigt (3).
Das Verhalten von Radon im Haus
Das Verhalten von Radon erklärt sich aus seinen Eigenschaften. Von den sechs natürlichen Edelgasen ist Radon das schwerste und rund siebenmal schwerer als Luft. Dadurch ist ihm das Vorrücken in die oberen Etagen erschwert, aber nicht unmöglich. Vor allem der Kamineffekt, der in hohen Gebäuden stärker zum Tragen kommt, erleichtert seine Durchmischung.
Dennoch nimmt die Radonkonzentration mit der Höhe des Stockwerks stark ab. Ein Home-Office im Keller ist deshalb eine schlechte Idee; es sei denn, Radonmessgeräte zeigen an, dass die Luft rein ist.
Warum besteht eine Gefahr für die Lunge?
Die Art der radioaktiven Strahlung, die weniger von Radon, als vielmehr von seinen langlebigen Abbauprodukten Wismut, Blei und Polonium ausgeht, ist die Alphastrahlung. Diese Form ist durch eine hohe Energieintensität sowie eine geringe Eindringtiefe gekennzeichnet. Für die vergleichsweise dicke und stabile Außenhaut geht deswegen kaum ein Risiko aus. Gelangt Radon aber in das sensible und empfindliche Gewebe der Lunge und Atmungswege, erhöht sich die Gefahr für Lungenkrebs schlagartig.
Die Bestrahlung der Hautschichten kann nämlich Mutationen in der zellulären DNS auslösen, die nicht immer von den für die Reparatur zuständigen Enzymen und Proteinen bereinigt werden können. Gelingt die Reparatur der beschädigten Zellen nicht und es kommt zu einer unkontrollierten Vermehrung, werden immer mehr gesunde Zellen befallen und der programmierte Zelltod wird ausgelöst und damit eine Apoptose.
Hilfreiche Maßnahmen gegen Radon
Um Radon dabei zu unterstützen, aus dem Haus zu entweichen, hilft regelmäßiges Stoß- und Querlüften, auch wenn dieses Verhalten den Grundsätzen einer energetischen Sanierung widerspricht. Zertifizierte Radon-Fachpersonen helfen bei der Identifikation von Radon-Eintrittspfaden, die sich anschließend mit Silikon verdichten lassen.
Um den Eintritt von Radon an der Quelle zu verhindern, können Bewohner einen Radonbrunnen oder eine Radondrainage installieren, um das Edelgas unter dem Fundament des Gebäudes abzusaugen.
Quellen:
